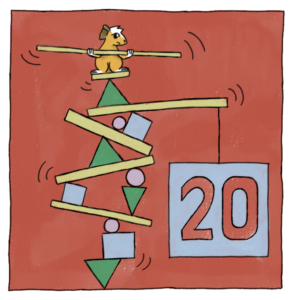„Wuff!“
Vor kurzem durfte ich Zeuge eines sehr interessanten Moments werden. Beteiligt waren ein sehr sensibler und emotional intelligenter Hund sowie etwa zwanzig Menschen. Die Menschen saßen beisammen und es wurden Dankesworte gesprochen. Nach jedem Dank wurde geklatscht. Doch offenbar fand der Hund dieses Verhalten etwas eigentümlich und fing jedes Mal beim Klatschen laut an zu bellen, bis alle ruhig waren.
Die Anwesenden verstanden schnell, dass dem Hund das Klatschgeräusch unangenehm war, und jemand kam auf die Idee, das ESL-Zeichen (European Sign Language) für „klatschen“ zu machen. Der erste stille Applaus wurde vom Hund mit sichtlicher Überraschung aufgenommen. Doch bereits beim zweiten Anlauf hatte er das Zeichen eingeordnet – und bellte nun auch auf Zeichen. Es folgten noch ein paar sehr verhaltene Beifallsbekundungen, doch insgesamt blieb die Stimmung positiv.
Das war ein großartiges Erlebnis. Jeder der Anwesenden begriff instinktiv, dass die Situation den Hund offensichtlich nicht unbeeindruckt ließ. Applaus scheint ihm unangenehm zu sein. Und alle gingen, so gut sie konnten, darauf ein. Jeder konnte sehen, dass der Hund nicht absichtlich versuchte, einen ganzen Raum zu kontrollieren. Jeder hatte Verständnis für sein Verhalten. Aus einer zunächst etwas skurril anmutenden Situation entstand eine gemeinschaftsstiftende Erinnerung.
Szenenwechsel.
Es ist Weihnachten. Die Familie sitzt zusammen um den Weihnachtsbaum herum. Der Tag war anstrengend, aber endlich ist es geschafft. Inzwischen sind auch schon die Geschenke ausgepackt, und während die Kinder noch voller Freude mit ihren neuen Errungenschaften spielen, schlägt Opa vor, doch noch ein paar Weihnachtslieder zu singen – so wie früher. Die Idee wird mit Freude aufgenommen und schon erklingen die ersten Töne von „O Tannenbaum“, als eines der Kinder plötzlich laut aufschreit und sich die Ohren zuhält.
Zunächst reagieren alle erschrocken, der Gesang verstummt. Besorgt wird nach dem Kind geschaut, doch es scheint alles in Ordnung zu sein. Also sicher falscher Alarm. Doch schon nach den ersten Tönen von „Stille Nacht“ schreit das Kind wieder fast panisch auf und presst die Hände über die Ohren. Auch das leicht verspätete „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder das allseits beliebte „O du Fröhliche“ ereilt das gleiche Schicksal des abrupten Abbruchs. Schließlich muss die Familie einsehen: Weihnachtslieder werden heute wohl keine mehr gesungen.
Doch anders als im ersten Beispiel erfährt ein Kind in einer solchen Situation eher selten echtes Verständnis. Wenn Trösten nicht funktioniert, folgen oft Frustration oder gar Wut von Seiten der Anwesenden. Das Kind gilt schnell als ungezogen. Immer müsse es seinen Willen bekommen, immer im Mittelpunkt stehen. Ständig kontrolliere es alle und zwinge ihnen seinen Willen auf. Aber hat das Kind nicht einfach nur gezeigt, dass es mit der Situation überfordert ist? Warum bekommt ein Hund Verständnis für seine Überforderung, ein Kind jedoch wird verurteilt?
Das Stichwort, das in solchen Situationen häufig fällt, lautet „Kontrollbedürfnis“. Gerade im autistischen Spektrum ist dieses Thema ein wiederkehrendes Phänomen. Betroffene gelten schnell als stur, dominant oder als Menschen, die alles bestimmen und ihren Willen durchsetzen wollen. Diese Sichtweise ist jedoch sehr einseitig. Viel zu selten wird gefragt, was eigentlich hinter diesem vermeintlichen Kontrollbedürfnis steht und wozu diese „Kontrolle“ überhaupt dienen soll.
Denn Kontrolle kann zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Auf der einen Seite steht das bewusste Kontrollieren anderer Menschen: ihr Verhalten zu steuern, Entscheidungen zu diktieren, Macht auszuüben. Auf der anderen Seite steht das Bedürfnis nach einer berechenbaren, sicheren Umgebung. Weder der Hund noch das Kind hatten das Bedürfnis, die Menschen um sie herum zu kontrollieren. Es ging ihnen schlicht darum, eine Situation zu beenden, die für sie unvorhersehbar, unangenehm oder überreizend war.
Autistischen Menschen wird von außen jedoch häufig unterstellt, sie wollten andere kontrollieren oder „ihren Willen durchsetzen“. Und ja, von außen betrachtet kann das Verhalten durchaus so wirken. Was dabei übersehen wird: Dieses Verhalten entsteht nicht aus Machtstreben, sondern aus einem tiefen Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Sicherheit bedeutet für viele Autisten vor allem Vorhersehbarkeit. Nur wenn eine Situation einschätzbar bleibt, ist es möglich, zu funktionieren. Der Schutzaspekt betrifft häufig die sogenannte Reizoffenheit. Geräusche, Licht, Gerüche oder soziale Dynamiken werden ungefiltert und in hoher Intensität wahrgenommen. Was für andere noch angenehm oder kaum bemerkbar ist, kann sich für reizsensible Autisten schnell überwältigend anfühlen.
Von innen heraus fühlt sich ein solcher Kontrollverlust oft wie der Beginn einer Panik an. Die Welt wird lauter, chaotischer, unberechenbarer. Der Körper gerät in Alarmbereitschaft. Der Versuch, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen, ist dann ein Versuch, sich selbst zu retten. Autistische Kontrolle richtet sich auf Situationen, nicht auf Menschen. Das Kind im Beispiel wollte nicht verhindern, dass die Familie singt. Es wollte eine Reizüberforderung beenden.
Im ersten Beispiel wurde all das nahezu mühelos verstanden. Dem Hund wurde keine Absicht unterstellt. Niemand kam auf die Idee, ihm Manipulation, Dominanz oder Kontrollsucht zuzuschreiben. Sein Verhalten wurde als das gesehen, was es war: ein unmittelbarer Ausdruck von Überforderung. Im zweiten Beispiel hingegen wird dem Kind, nachdem offensichtliche Ursachen wie Verletzungen ausgeschlossen wurden, sehr schnell eine Absicht zugeschrieben, die es nicht hatte und gegen die es sich auch nicht wehren kann.
Dabei geht es nicht darum, Hund und Kind miteinander zu vergleichen oder gar gleichzusetzen. Es geht um den Unterschied im Umgang. Dem Hund wird hier zugestanden, dass sein Verhalten aus einem inneren Erleben heraus entsteht, das für ihn real und belastend ist. Dem Kind wird dieses innere Erleben häufig abgesprochen. Sein Verhalten wird moralisch bewertet, nicht situativ verstanden. Und genau dieser Perspektivwechsel macht den entscheidenden Unterschied.
Vor einiger Zeit bin ich in einem Artikel über eine interessante Aussage zu PDA gestolpert – Pathological Demand Avoidance. PDA ist ein gesellschaftlich noch recht unbekanntes und wissenschaftlich noch nicht klar definiertes und somit umstrittenes Konzept, das jedoch zunehmend als Teil des autistischen Spektrums diskutiert wird. Als ich den Begriff zum ersten Mal las, fand ich ihn ausgesprochen verwirrend. „Pathologische Anforderungsvermeidung“ klingt danach, als würden Anforderungen grundsätzlich konsequent und mit klinischer Relevanz vermieden werden. Für mich klang das zunächst seltsam und wenig nachvollziehbar. Warum sollte jemand Anforderungen an sich selbst oder von außen pauschal vermeiden?
Der Artikel stellte jedoch eine ganz andere Perspektive vor. Es gehe bei PDA nicht um das Vermeiden von Aufforderungen an sich. Vielmehr würden Aufforderungen von außen von Betroffenen als massiver Kontrollverlust erlebt. Die Situation wird als bedrohlich, überwältigend und im Extremfall sogar lebensgefährdend empfunden. Aufforderungen werden nicht vermieden, weil sie lästig sind, sondern weil sie ein Gefühl absoluter Ohnmacht und Angst auslösen. Dieses Gefühl kann erst dann nachlassen, wenn es gelingt, die Kontrolle über die Situation wiederherzustellen.
In diesem Licht betrachtet wirkt PDA wie eine Extremform dessen, was im autistischen Spektrum ohnehin häufig zu beobachten ist: der Versuch, Sicherheit herzustellen, wenn innere und äußere Reize überhandnehmen. Genau das macht die Annahme, PDA könne Teil des autistischen Spektrums sein, für mich sehr nachvollziehbar.
Ein hilfreicher Umgang mit solchen Mustern beginnt daher womöglich nicht bei Korrektur oder Konsequenz, sondern bei Verständnis für die Situation, in der sich Betroffene im Moment des Kontrollverlusts befinden. Hilfreich kann es sein, Anforderungen in Angebote umzuwandeln, Wahlmöglichkeiten zu schaffen oder Zeitdruck herauszunehmen. Auch Transparenz und Vorhersehbarkeit spielen eine große Rolle: zu erklären, was passieren wird, warum etwas notwendig ist und welche Handlungsspielräume bestehen. Vor allem aber hilft es, Verhalten nicht vorschnell zu bewerten, sondern als Kommunikation zu verstehen und als Ausdruck eines inneren Zustands, für den es in diesem Moment vielleicht keine anderen Worte gibt.
Vielleicht liegt genau hier der Schlüssel. Wenn wir beginnen, Verhalten weniger nach seiner Wirkung auf uns und mehr nach seiner Ursache zu betrachten, entsteht Raum für Verständnis. Raum dafür, Überforderung nicht als Ungehorsam zu lesen, sondern als das, was sie ist: ein Signal. Und manchmal reicht es schon, dieses Signal ernst zu nehmen, um aus einer schwierigen Situation eine tragfähige, gemeinsame Erfahrung werden zu lassen.