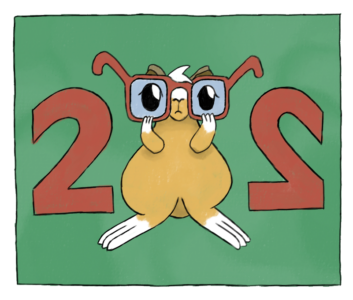„Früher gab’s das alles nicht“
Im Jahre 1300 nach Christus betrug die Zahl brillentragender Menschen nördlich der Alpen, leicht gerundet, etwa null Prozent. Erst um 1400 herum finden sich nach und nach Belege dafür, dass Brillen von einzelnen Individuen getragen wurden. Im 19. Jahrhundert wurde dann ein merklicher Anstieg an Brillenträgern in der Gesellschaft festgestellt. Klare Zahlen haben wir jedoch erst für das Jahr 1952, in dem überwältigende 43 Prozent der Bevölkerung Deutschlands über 16 Jahre eine Brille trugen. 2008 zeigte sich ein weiterer, scheinbar schockierender Anstieg, denn inzwischen lag der Prozentsatz bei 62. Das ist eine fast 45-prozentige Steigerung gegenüber 1952!
Man könnte fast schon von einer Pandemie der Fehlsichtigkeit sprechen. Immer mehr Menschen sind auf Brillen angewiesen – das kann doch wohl nicht sein! Früher war das nicht so, da brauchte man keine Brillen. Was sind die Leute heute doch verweichlicht. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Früher hätte man da einfach mal kräftig …
Das ist natürlich ausgemachter Blödsinn.
Dass es vor 1300 keine Brillenträger nördlich der Alpen gab, lag schlicht daran, dass die Brille erst wenige Jahre zuvor in Italien und somit südlich der Alpen erfunden worden war. Neue Erfindungen brauchten damals noch entsprechend lange, um sich zu verbreiten. Der erste Anstieg im 19. Jahrhundert ist auf neu entwickelte Techniken zurückzuführen, die Brillen erschwinglich machten und sie damit aus dem Status eines Luxusguts herausholten. Der Anstieg zwischen 1952 und 2008 lässt sich vor allem durch bessere Vorsorge, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, erklären. Fehlsichtigkeiten werden heute sehr viel früher erkannt als noch vor 70 Jahren.
Zu keinem Zeitpunkt gab es jedoch „keine Fehlsichtigen“. Menschen (und auch Tiere mit vergleichbar aufgebauten Augen) konnten schon immer unterschiedlich gut sehen. Es gab lediglich keine flächendeckenden Hilfsmittel wie erschwingliche Brillen, und auch die Möglichkeiten heutiger Sehtests sind eine Errungenschaft der Moderne. Flächendeckende Vorsorgeuntersuchungen waren im Jahr 1476 schlicht noch nicht üblich.
Die Zahlen sind also logisch durch externe Faktoren erklärbar, die nicht in einem direkten oder zwangsläufigen Zusammenhang mit einer tatsächlichen Verschlechterung der Sehfähigkeit des Menschen stehen. Das scheint nicht schwer zu verstehen zu sein, denn erstaunlicherweise hört man nur sehr selten von einer „Pandemie der Fehlsichtigkeit“, die sich in immer weiter steigenden Brillenverkäufen äußert. Ich wage sogar die Behauptung aufzustellen, dass viele heute zum ersten Mal von diesem Begriff lesen.
In anderen Bereichen der Medizin (denn auch Fehlsichtigkeit ist ein solcher) sieht das allerdings ganz anders aus, insbesondere im Bereich psychischer Diagnosen. Die Anzahl der Autismus- und ADHS-Diagnosen im Jahr 1925 liegt bei einer gesicherten Null. Das lässt sich auch ganz ohne Quelle sagen, denn beide Diagnosen existierten zu diesem Zeitpunkt schlicht noch nicht. Auffällige Menschen gab es selbstverständlich auch damals, sie wurden jedoch anders beschrieben, anders eingeordnet oder gar nicht systematisch erfasst. Es ist daher nur folgerichtig, dass heute deutlich mehr entsprechende Diagnosen existieren als noch vor hundert Jahren.
Betrachtet man, wie stark sich die Psychologie in dieser Zeit entwickelt hat und sich weiterhin am entwickeln ist, ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Anzahl psychisch bedingter Diagnosen kontinuierlich steigt. Phänomene werden beobachtet, untersucht, differenziert, kategorisiert und schließlich diagnostiziert. Mit jeder neuen Erkenntnis kommen neue Begriffe, neue Kriterien und damit auch neue Diagnosen hinzu, die entsprechend vergeben werden.
Doch anders als bei der Brille stößt man im Zusammenhang mit psychologischen Diagnosen immer wieder auf Aussagen wie den Kampfbegriff der „Pandemie der Diagnosen“ oder das altbekannte „früher gab’s das nicht“. Nicht selten gesellen sich dazu äußerst fragwürdige Erziehungstipps, mit denen sich in der Kindheit der Sprechenden offenbar jedes psychische Problem hätte lösen lassen.
Auffällig ist dabei, dass mit dem Anstieg der Diagnosen auch ein Anstieg meist hochgradig polemischer Artikel zu beobachten ist. Diese versuchen, Betroffenen großflächig Diagnosen abzusprechen, Diagnosen zu verharmlosen oder sie als Ergebnis von Erziehungsfehlern, Überbehütung oder mangelnder Disziplin darzustellen. Der Fokus liegt dabei selten auf Aufklärung, sondern vielmehr auf Abwertung und Vereinfachung.
Solche Artikel benennen in der Regel zwar Zahlen korrekt, lassen jedoch viele der relevanten Faktoren, die diese Zahlen erklären würden, vollständig unerwähnt oder nutzen sie auf eine Weise, die trotz formaler Richtigkeit ein verzerrtes Bild erzeugt. In meiner Einleitung schrieb ich vom Anstieg der Brillenträger zwischen 1952 und 2008. In beiden Jahren wurden Umfragen zum Thema durchgeführt, deren Ergebnisse ich herangezogen habe, um die Aussage zu treffen, dass ein fast 45-prozentiges Wachstum stattgefunden hat. Diese Aussage ist formal korrekt, hinterlässt jedoch einen trügerischen Eindruck.
Ein 45-prozentiges Wachstum (45 ist ja fast 50 und damit assoziativ „fast die Hälfte“) erzeugt emotional den Eindruck einer enormen Steigerung. Dabei ist ein Anstieg von 43 auf 62 Prozentpunkte durchaus beachtlich, klingt jedoch weniger dramatisch. „45-prozentiges Wachstum“ wirkt erheblich größer als „um 19 Prozentpunkte gestiegen“. Ein Wachstum von 4,3 auf 6,2 Prozent ist übrigens ebenso ein „fast 45-prozentiges“ Wachstum wie das von 0,43 auf 0,62 Prozent. Ein Anstieg in der ersten Nachkommastelle eignet sich jedoch kaum für eine reißerische Schlagzeile.
Auf diese Weise werden Wachstumsraten teils sehr geschickt genutzt, um kleine, gut erklärbare Entwicklungen enorm groß wirken zu lassen, wodurch polemische Begriffe wie „Pandemie“ scheinbar eine moralische Berechtigung erhalten.
Diese Artikel sind weder Wissenschaft noch neutrale Meinungsäußerung. Sie sind meinungsbildende Stimmungsmache. Sie entwerten Diagnosen und letztlich auch die Menschen, die sie erhalten haben. Sie verunsichern Betroffene, bauen Barrieren und Hürden auf und tragen zu einer Gesellschaft bei, in der Abweichung nicht mit Respekt und Akzeptanz, sondern mit Empörung begegnet wird.
Dabei sind Diagnosen kein Modephänomen und kein Etikett, das leichtfertig vergeben wird. Sie sind Werkzeuge, um Phänomene zu beschreiben, um Zugang zu Unterstützung zu ermöglichen und um Menschen eine Sprache für das zu geben, was sie erleben. Eine Diagnose schafft keine Probleme. Sie benennt sie. Und oft ist genau diese Benennung der erste Schritt zu Verständnis, Selbstakzeptanz und passender Unterstützung.
Dass wir heute mehr sehen, mehr benennen und mehr verstehen als früher, ist ein Zeichen von Fortschritt. Für Betroffene bedeutet das nicht, „mehr krank“ zu sein als frühere Generationen, sondern gesehen zu werden. Und Sichtbarkeit ermöglicht Hilfen und Unterstützung, die früher undenkbar gewesen wäre.
Wenn man also sagt: „Früher gab’s das alles nicht“, dann stimmt das vielleicht in einem sehr engen, formalen Sinne. Denn was es „früher“ nicht gab, sind Wissen, Worte und Strukturen, um diese Phänomene beschreiben und verstehen zu können. Dass es sie heute gibt, ist letzten Endes ein Gewinn für uns alle.